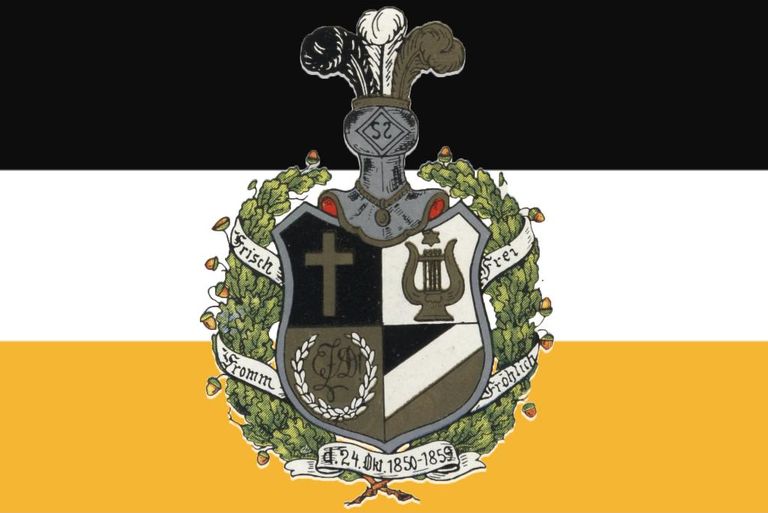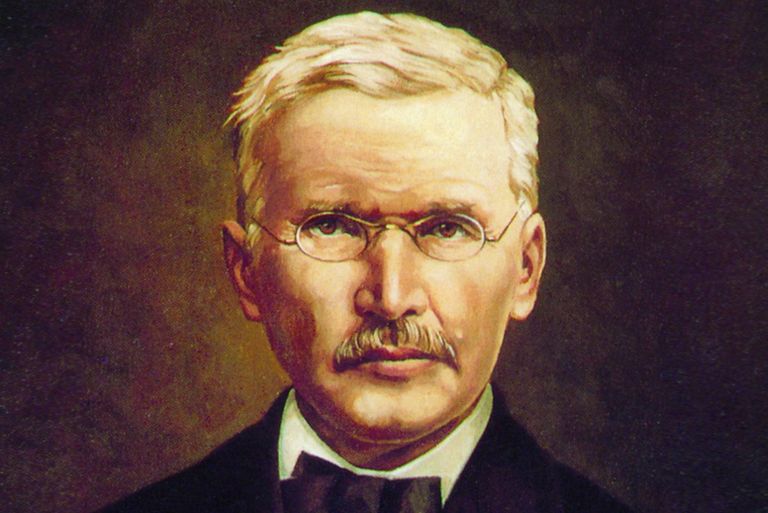„Sie wollen keine Preßfreiheit, weil sie glauben, der Wind drehe sich nach der Wetterfahne“ – so spottete der Dichter und Journalist Ludwig Börne (1786–1837), einer der wichtigsten Vorkämpfer für Demokratie in Deutschland, einst über die Gegner der liberalen Bewegung. Mit diesen Worten spricht Börne, ein Dilemma an, dem sich jedes Medium, jeder Journalist immer wieder von Neuem stellen muss: Wind oder Wetterfahne?
In welchen Phasen ihrer Geschichte die Wingolfsblätter eher „Wind“ in welchen eher „Wetterfahne“ waren, dieser Frage soll – anschließend an die bisherigen Teile (1872–1918 in Wbl. 3/2023, S. 13–20; 1918–1938 in Wbl. 1/2024, S. 10–26) – auch im dritten Teil dieses Beitrags zur Geschichte der Wingolfsblätter nachgegangen werden.
Der Beitrag erschien im Original in den Wingolfsblättern 2/24 auf den Seiten 13–22. Autor ist Andreas Rode (Mz 88, Br 89, Mch 08). Die insgesamt 51 Fußnoten sind in der Onlinefassung nicht enthalten.
Er steht am Ende und am Beginn einer Ära des Wingolfs und der Wingolfsblätter: Dr. iur. Wilhelm Lütkemann (M 10, G 12 et al.). Als VAW-Vorsitzender hatte er die traurige Pflicht gehabt, den Wingolfsblättern das letzte Geleit zu geben. „Niemand wird uns schelten, daß der Abschied uns schmerzt, wie wenn wir den treuesten Freund ins Grab legten“, hatte er im September 1938 seinem „Nachruf“ geschrieben. Elf Jahre später, im November 1949, durfte er in Heft 1 der wiederbegründenden Wingolfsblätter Gott dafür danken, dass der Wingolf und mit ihm auch die Wingolfsblätter zu neuem Leben erwachten:
„ER hat es gewendet. In überraschend kurzer Zeit sind über ein Dutzend Wingolfsverbindungen wieder neu entstanden; sie haben in ihrem Zusammenschluß den Wingolfsbund wieder existent gemacht. Der Verband Alter Wingolfiten mit seinen Bezirksverbänden und die Philistervereine der einzelnen Verbindungen bestehen wieder in aller Form, und eine Wartburgtagung hat in der Pfingstwoche zu Eltville am Rhein Jung und Alt in Harmonie am Gesamtbau werken gesehen. Das Faktum ist also da. Gott hat es uns geschickt. Daß es ein Gutes werde, dafür haben wir nun zu sorgen, und da wir nichts ohne seinen Segen ausrichten können, setzen wir die Bitte darum als Überschrift über die erste Nummer unserer Wingolfsblätter.“
Aufbaujahre
Das Wiederauflebens des Wingolfs, das Lütkemann beschreibt, prägt die ersten Jahrgänge der neu entstandenen Wingolfsblätter. Als ein halbes Jahr nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland die erste Nachkriegsausgabe erschien, waren die Wingolfsverbindungen in Bonn, Darmstadt, Erlangen, Gießen, Göttingen, Heidelberg, Kiel, Marburg, Münster, Stuttgart und Tübingen bereits wiedergegründet. Als „ganz neue“ Wingolfsverbindungen existierten Braunschweig und Mainz sowie die Fraternitas Academica Hohenheim, deren Gründung unabhängig vom ehemaligen Hohenheimer Wingolf erfolgt war. Weitere Neu- und Wiedergründungen folgten, über die in den Wingolfsblättern freudig berichtet wurden.
Auch der Erwerb bzw. die Wiedererlangung der Verbindungshäuser war ein großes Thema: Davon zeugen zunächst kleine Anzeigen, wie diejenige aus dem Sommer 1951, in der es heißt: „Die frühere Satzung des Marburger Bauvereins wird in dem Verfahren betr. Wiedererwerb des Hauses dringend benötigt. Wer sie noch besitzt, sende sie sofort an …“ Im Verlauf der 1950er- und 1960er-Jahre folgen dann immer mehr Berichte über Hausbautätigkeiten, Wiedergewinnung von Wingolfshäusern und Hausweihen. Welchen Einsatz – sowohl an Arbeitskraft als auch an finanziellen Mitteln das forderte, lassen z. B. die Berichte über den Bau des Hauses in Darmstadt erahnen. Dieses war in den Jahren 1950 bis 1952 als erstes Wingolfshaus komplett neu errichtet worden. Das alte Haus hatte, wie die meisten Wingolfshäuser, in der Nazizeit erzwungenermaßen den Besitzer gewechselt. Doch an eine Rückforderung war nicht zu denken: „Sein derzeitiger Besitzer war schon vor dem Zusammenbruch wieder in der Lage, das Grundstück neu zu bebauen, was für uns insofern von Bedeutung wurde, als die Möglichkeit, einen Anspruch geltend zu machen, dadurch von vornherein entfiel“, heißt es in den Wingolfsbblättern. Mit vereinten Kräften wurde deshalb ein Grundstück erworben und von den Wingolfiten selbst von den Trümmern des zerbombten Vorgängerbaus freigeräumt. Dann erst konnte – ebenfalls größtenteils aus eigenen Kräften – die Errichtung eines Neubaus erfolgen.
Nicht weniger, wenn auch andere Schwierigkeiten brachten die Rückerstattungsverfahren mit sich. Im Mai 1955 dokumentieren die Wingolfsblätter den Rechtsstreit, an dessen Ende der Marburger Wingolf sein Haus zurückerhielt, und drucken die Urteilsbegründung des OLG Frankfurt/Main ab.
Ein Blick auf die in den Wingolfsblättern veröffentlichten Semesterberichte der einzelnen Wingolfsverbindungen offenbart auch in anderer Hinsicht einen Aufschwung: Die Zahl der Aktiven steigt kontinuierlich und die wirtschaftliche Lage bessert sich zunehmend. Ist anfangs fast durchgehend von beschränkten Räumlichkeiten, bescheidenen finanziellen Mitteln und behördlichen Behinderungen die Rede, werden bald schon die Stiftungsfeste üppiger und die Ausflüge häufiger – eine Entwicklung, die parallel zum ökonomischen Aufschwung der Bundesrepublik und den Jahren des „Wirtschaftswunders“ zu sehen ist. Auch die Berichte von Konventionen und Wartburgfesten – die damals noch immer in der Pfingstwoche von Dienstag bis Donnerstag stattfanden – spiegeln diesen Aufschwung. Neu ist dabei, dass Eisenach und die Wartburg nicht mehr zugänglich sind. Die Wartburgfeste finden daher an unterschiedlichen Orten statt – z. B. in Weilburg an der Lahn oder in Freudenstadt im Schwarzwald. In den Wingolfsblättern findet sich dann im Vorfeld neben den üblichen Informationen zum bevorstehenden Wartburgfest jeweils auch eine „touristische Werbung“ für die jeweilige Stadt.
Aufbau ist auch auf Verbandsebene erforderlich: Bei der Wartburgtagung in Eltville wird im Juni 1949 entschieden, die unter Zwang eingeleitete Liquidation des Verbandes Alter Wingolfiten (VAW) aufzuheben. In der Folge wurde – angelehnt an die alte Satzung – eine neue Satzung erarbeitet und in späteren Jahren immer wieder reformiert. Mit Beschluss des Wartburgphilistertages beim Wartburgfest in Siegen 1965 wurden zudem neben den Bezirksverbänden auch die Philistervereine Mitglieder des VAW. Über all diese strukturellen Veränderungen wird in den Wingolfsblättern debattiert, die Ergebnisse werden dokumentiert.
Was über all dieser Aufbruchsstimmung nicht in Vergessenheit geraten sollte: Diktatur und Krieg haben Millionen von Todesopfern gefordert. Andere haben in dieser Zeit schwere Verletzungen – physische wie psychische – davongetragen. Menschen werden vermisst, sind in Kriegsgefangenschaft, haben Familienangehörige und nahe Freunde verloren. Das alles betrifft auch den Wingolf und findet in den Wingolfsblättern seinen Niederschlag. Ein anrührendes Beispiel dafür ist der Artikel „Haus zerstört, Adresse unbekannt“ aus der Ausgabe vom Februar 1950. Lütkemann beschreibt hier die Schwierigkeiten, die sich mit der ersten Aussendung der Wingolfsblätter verbunden haben, und betont, dass „besonders der Brüder gedacht werden soll, die noch nicht erreichbar waren oder nicht mehr zu erreichen sind.“ Und weiter heißt es: „Unser Statistiker wird in langwieriger Arbeit ermitteln, wer gestorben, gefallen und durch den Krieg sonstwie umgekommen ist; ihre Zahl ist erschütternd groß! (…) In Ehren sollen auch alle die Angehörigen der Vollendeten gehalten werden, die wissen und bekunden, was der Wingolf ihrem Vater oder Bruder oder Mann oder Verlobten oder Sohn bedeutet hat, und die in seinem Namen an unserem Wiedererstehen Teil nahmen, unter Umständen sogar materielle Hilfe dazu leisteten.“
Ein ganz konkretes Beispiel dafür, welche Schicksale die Überlebenden belasten, wird von Lütkemann im November 1951 dokumentiert. Unter der Überschrift „Wie geht es unserem Rodenhauser?“ berichtet er, dass Rodenhausers Kriegsverletzung aus dem Ersten Weltkrieg inzwischen zu vollständiger Lähmung geführt hat. Nicht mehr arbeitsfähig hatten er und seine Frau bei Freunden im Sudetenland Aufnahme gefunden. Rodenhauser selbst hat Lütkemann – übermittelt durch seinen Sohn – von seinen Erlebnissen im Jahr 1945 berichtet: „Es folgte eine furchtbare Fluchtfahrt von 35 Tagen kreuz und quer durch die in Aufruhr befindliche Tschechoslowakei mit grauenhaften Erlebnissen und mit russischer Gefangenschaft. Ich verdanke die Rettung meines Lebens dem heldenmütigen Einsatz meiner Frau, die mich gelähmten, immer auf der Bahre liegenden Mann durch alle Schwierigkeiten und Gefahren unerschrocken hindurchlavierte.“
Rodenhausers Schicksal ist nur eines unter vielen, und viele haben sicherlich noch weitaus Schlimmeres erlitten. Dennoch gibt es eine Ahnung davon, mit welchen Erinnerungen und Erfahrungen die Wingolfiten jener Jahre belastet waren, auch und gerade die Aktiven, von denen nicht wenige an der Front und in Gefangenschaft Schreckliches erlebt hatten. Doch gerade der Verweis auf Rodenhauser, der als „Wingolfsführer“ den Arierparagraphen im Wingolf durchzusetzen hatte, lässt noch etwas anderes anklingen: Die Frage nach dem eigenen Schuldigwerden des Wingolfs und einzelner Wingolfiten und nach der Selbstverortung in der neuen Zeit. Auf diese beiden Aspekte soll in den nächsten Abschnitten eingegangen werden.
Ortsbestimmung
In einer Zeit, in der die Zeichen auf „Neuanfang“ stehen, ist es besonders wichtig, sich seiner selbst zu vergewissern und im Lichte früherer Erfahrungen – guter wie schlechter – nach dem eigenen Standort zu suchen. Solche Selbstverortung findet auch in den Wingolfsblättern statt. Angesichts der militärischen wie auch moralischen Katastrophe ist es, anders als 1918, dieses Mal keine Frage, dass der Wingolf als Ganzes sich rückhaltlos zur Demokratie und zum neu entstandenen Staatswesen bekennt. Dies wird weniger in dem einen großen programmatischen Artikel deutlich als vielmehr in dem Grundton, der bei den Beiträgen mitschwingt. Dr. Bernhard Dammermann (G 12, Gd 13), der in den 1950er-Jahren regelmäßig in den Wingolfsblättern publiziert, erinnert etwa unter der Überschrift „Student und Politik“ daran, dass „Partei“ vom lateinischen „pars“ komme. Davon ausgehend betont er, dass jede Partei nur Teil eines größeren Ganzen sei und daher niemals einen Absolutheitsanspruch für sich reklamieren können. Eine klare Absage an alles totalitäre Gedankengut! Vergleichbares lässt sich in den Wingolfsblättern immer wieder finden.
Angesichts dieses weitgehenden Grundkonsenses ist es ein echter Paukenschlag, als zu Anfang des Jahres 1962 unter der Überschrift „Gesellschaft ohne Gott und Kaiser“ ein längerer Artikel von Helmut Scheide (G 30, K 31, Bg 67) erscheint.9 Der Verfasser tritt deutlich für die Regierungsform der Monarchie ein und propagiert ein theologisch unterfüttertes „Gottesgnadentum“. Seine Thesen zusammenfassend schreibt er: „Die Lösung der Zeitprobleme fordert ein mutiges und frommes Geschlecht. Mögen die alten Autoritäten auch äußerlich zerbrochen sein, ihr Geist findet noch immer seine Bekenner. (…) In entscheidungsvollen Stunden wird man sich um die wenigen sammeln, die (…), stets dankbar für das Erbe der Väter auch des Geistes und der Haltung der Ahnen würdig leben wollen. Wer sich dem Zeitgeist und seinen Modetorheiten feige ergibt, ohne nach Recht und Gerechtigkeit zu fragen, wird nie ein freier Mann.“10 Dass die Redaktion der Wingolfsblätter unter Schriftleiter Erich Warmers (E 47, M 48, Ft 55) diesen monarchistisch geprägten Beitrag eher als Debattenbeitrag verstanden wissen wollte, zeigt sich darin, dass direkt im Anschluss an den zitierten Artikel Scheides im selben Heft Dr. Adolf Quast (G 29, Bg 49) unter der Überschrift „Korporation und Demokratie“ eine gänzlich andere, entschieden demokratische Position vertritt.
Das Echo, das Scheides Artikel hervorruft, ist jedenfalls beachtlich. Selten dürften die Wingolfsblätter so viele Leserzuschriften gehabt haben. Die Stellungnahmen im Folgeheft umfassen nicht weniger als zwölf Seiten. In einer einzigen Leserzuschrift wird Zustimmung bekundet, der Rest widerspricht Scheide vehement. Der Tübinger Wingolf gibt in seiner Stellungnahme sogar zu Protokoll: „Der Convent des Tübinger Wingolf distanziert sich von dem Artikel Gesellschaft ohne Gott und Kaiser‘ in Heft 1/62 der Wingolfsblätter (…) Der Tübinger Wingolf erkennt das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Verpflichtung, sich für die Wahrung und Förderung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung einzusetzen, als für sich verbindlich an. Dieser Beschluß wurde bei einer Enthaltung ohne Gegenstimme gefaßt.“ Weitere Leserzuschriften sowie eine – eher apologetische Stellungnahme – von Scheide selbst folgen in Heft 3.
Ein wichtiges Thema sind in diesen Jahren auch die Kritik weiter gesellschaftlicher Kreise, die den studentischen Korporationen unter den neuen politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten das Existenzrecht absprechen wollen. Gegen den Vorwurf des Anachronismus betont man in den Wingolfsblättern unter anderem, dass gerade Aspekte wie Zusammenhalt, brüderliches Füreinandereinstehen und nicht zuletzt das althergebrachte demokratische Konventsprinzip sehr wohl in die Zeit passen. Über die Jahre wird es immer wieder nötig, dass der Wingolf sich gegen solche Kritik von außen zur Wehr setzt. Prominentestes Beispiel ist aber sicherlich die bereits zu Beginn des Jahres 1950 erfolgte Auseinandersetzung mit der Position von Bundespräsident Theodor Heuß, der sich wiederholt skeptisch bis abwehrend zum Wiedererstehen der Korporationen äußert. Die Wingolfsblätter dokumentieren dazu eine Ansprache, die Heuß im Dezember 1949 an der Heidelberger Universität hält. Antworten unter anderem vom VAW-Vorsitzenden Lütkemann und vom Bundes-x Heinz Miederer (E 48, Hg 50) sind im gleichen Heft abgedruckt. Das Thema wird den Wingolf (wie die Verbindungen insgesamt) von nun an begleiten. Immerhin eins bewirkt die starke Kritik von außen: Die Korporationsverbände grenzen sich nicht mehr so sehr voneinander ab. Statt Arroganz und Dünkelhaftigkeit herrscht nur ein ernsthaftes Interesse an Zusammenarbeit vor, das im Convent deutscher Korporationsverbände (CDK) und im Convent deutscher Akademikerverbände (CDA) seinen organisatorischen Niederschlag findet. Berichte von dieser Zusammenarbeit und Informationen aus dem Leben anderer Dachverbände nehmen in den Wingolfsblättern jener Jahre einigen Raum ein.
Während in der oben skizzierten Frage nach der Existenzberechtigung studentischer Korporationen innerhalb des Wingolfs Einigkeit herrscht, gibt es deutlich unterschiedliche Ansichten zu Fragen des Comments. Kristallisationspunkt ist hier vor allem die Frage des Couleurtragens in der Öffentlichkeit. Abgesehen davon, dass eine Genehmigung der Behörden keineswegs selbstverständlich ist, stehen hier die Meinungen gegeneinander. Die Debatte lässt sich in den Wingolfsblättern über viele Jahre nachverfolgen: Bereits 1952 vermerkt z. B. Prof. Dr. H. G. Bluth (Gd 19, G 20) unter Bezugnahme auf einen zwei Ausgaben zuvor erschienenen Artikel von Dammermann: „Wir können nicht mehr (…) Form und Inhalt des Wingolfsgedankens problemlos nebeneinanderstellen.“ Die Debatte um studentische Symbolik wie Couleur, Vollwichs und Burschenfeier wird über die folgenden Jahre nicht abebben und 1968 einen neuen Höhepunkt erleben. Doch scheint die Mehrheit der Wingolfiten ihre Freude an den farbenfrohen äußeren Zeichen ihres Bundes zu haben. So ist es denn auch kein Wunder, wenn wiederholt mit unverkennbarer Freude Meldungen wie diese veröffentlicht werden: Anfang Februar 1967 „beschloß der Senat der Westfälischen Wilhelm-Universität, einem Antrag der farbentragenden Verbindungen entsprechend, bei bestimmten Anlässen innerhalb des Universitätsbereiches das bislang verbotene Farbentragen zu gestatten.“
Nebenbei bemerkt: Bis zur Mitte der 1960er-Jahre saßen auch noch viele Korporierte in den Studentenparlamenten und dem einen oder anderen AStA. Und so ist es auch nicht allzu verwunderlich, wenn man in den Wingolfsblättern lesen kann, dass das Studentenparlament Gießen „das Verbot des Farbentragens für eine unangemessene, unbefriedigende und unberechtigte Form der Auseinandersetzung“ hält.
Themen der Zeit
Der Wingolf sucht jedoch auch über die „typisch korporativen“ Fragen hinaus seine Position. Zu vielen religiösen, politischen und kulturellen Themen ist in den Wingolfsblättern etwas zu lesen. An dieser Stelle kann dies aus Platzgründen nur kursorisch mit kurzen Beispielen angerissen werden. Eher selten geht es um Technisches wie bei dem Artikel „Elektronenrechner als Bibliothekar“.
Was viele Wingolfiten beschäftigte, waren politische Fragen. So setzt sich etwa Dr. Ulrich Schneider (Bo 48) kritisch, aber nicht ohne Wohlwollen mit dem „Verhältnis der Korporationen zur SPD und zum SDS“ auseinander. Ein wichtiges Thema ist dabei der Blick die DDR und die ehemals deutschen Gebiete weiter im Osten. Hier treffen sich sowohl das politische Interesse als auch die ehrliche Sorge um konkrete Personen. Nahezu jeder hat Verwandte, Freunde oder eben Wingolfsbrüder, die betroffen sind. Ein Beitrag wie der Artikel „Wie lange gibt es noch den deutschen Osten?“ von Dr. Hans Hermann Schepermann (Bo 48) mag hier als Beispiel dienen.
Die Auseinandersetzung mit der „SBZ“, der „Sowjetischen Besatzungszone“, und später der DDR erfolgte aber nicht nur theoretisch. Die Wingolfiten wurden auch ganz praktisch tätig, was sich in den Wingolfsblättern spiegelte. Der bundesbrüderliche Zusammenhalt wirkte auch über die innerdeutsche Grenze hinweg und wiederholt wurde mit großem Erfolg zur „Osthilfesammlung“ des Wingolfs aufgerufen. Für solche konkrete Hilfe und noch mehr dafür, dass sie bei den Bundesbrüdern nicht in Vergessenheit geraten waren, gab es auch herzliche Danksagungen der Betroffenen in den Wingolfsblättern. Allerdings – und das führt die Besonderheit der Situation in anrührender Weise vor Augen – aus Furcht vor Repressionen nur anonym. So ist etwa im März 1955 unter der Überschrift „Ein Gruß aus dem Osten“ in den Wingolfsblättern zu lesen: „Hochverehrter, lieber Konphilister. Die unterzeichneten Wingolfsphilister aus … und Umgebung grüßen von einem schönen, einzigschönen Beisammensein bei Kph. … Dich und den ganzen Wingolfsbund von ganzem Herzen. Ich sende diesen Gruß zur Vorsicht aus Berlin ab. – Mehrere waren im Sommer in Westdeutschland, alle aber durch Aufenthalt bei Verwandten so gebunden, daß die Aufnahme neuer Verbindung mit dem Bund meist nicht gelang. Wir vergessen Euch nicht, dafür ist in vieler Hinsicht gesorgt.“ Nirgendwo in dem Abdruck wird ein Name genannt, stattdessen endet der Brief nur mit den Worten „Mit herzlichen und sehnsuchtsvollen Grüßen – 16 Unterschriften“. Immerhin: Noch waren Westreisen möglich. Wenige Jahre später sollte sich auch das ändern. „Mögen die Bande zwischen uns und Euch, je länger Deutschland geteilt bleibt, desto enger werden – und nicht loser. Die Zeiten rufen nach Beweisen erfinderischer Liebe und Verbundenheit.“ Unter den sich verschärfenden Bedingungen, wurde es schwierig, diesen Wunsch der „Ostphilister“ zu erfüllen.
Im Mai 1961 fragt Karl Kromphardt mit Blick auf die beiden deutschen Staaten: „Ist Koexistenz möglich?“ und gibt in dem nachfolgenden Artikel eine eher skeptische Antwort, aber auch er hat sicherlich nicht damit gerechnet, dass bereits wenige Monate später eine Mauer quer durch Berlin gebaut werden würde. In der ersten Hälfte der 1960er-Jahre ist überraschenderweise kaum etwas über den Mauerbau selbst in den Wingolfsblättern zu lesen. Möglicherweise hat man es angesichts der Prominenz des Themas in den allgemeinen Medien nicht für nötig gehalten, auch in den Wingolfsblättern ausführlich darüber zu debattieren. Hier spiegelte sich eher die direkte Hilfe und konkrete Verbundenheit, so etwa in den Anzeigen, in denen Werner Foerster-Baldenius v/o Foenius (Ch 19 et al.) um Unterstützungsgüter warb, die er auf seinen nicht ganz ungefährlichen Reisen den Conphilistern in der DDR überbringen konnte oder in den Berichten über die viele Jahre lang von der Clausthaler Wingolfsverbindung Catena ausgerichteten Ferienfreizeiten für Berliner Kinder.
Immer wieder neu hinterfragt wird, welche Position man als Christ zu Krieg und militärischer Rüstung einnehmen solle. Mit der Wiederbewaffnung Deutschlands setzen sich zu Beginn des Jahres 1957 gleich mehrere Beiträge auseinander. Ein Jahr später beziehen Dr. C. G. Schweitzer (H 10) und Ernst Wilm (H 21) unter der Überschrift „Muß und darf die Atomwaffe die Christen spalten?“ unterschiedliche Positionen zur Frage der nuklearen Bewaffnung im Ost-West-Konflikt.
Theologische Fragen spiele eine deutlich geringere Rolle als in früheren Zeiten, was vor allem daran liegen dürfte, dass der Anteil von Theologen im Wingolf gegenüber der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts deutlich gesunken ist. An der christlichen Selbstverortung des Wingolfs ändert das jedoch nichts, sie nach wie vor überall zu spüren. In einer Hinsicht hat die Auseinandersetzung mit Religionsfragen allerdings zugenommen: Da inzwischen mehr Katholiken ihren Weg in den Wingolf gefunden haben, wird nun auch öfter gelebte Überkonfessionalität angemahnt. Besonders prägnant wird dies deutlich, als der Kölner Wingolf sich 1961 mit einem Bundesantrag gegen das Singen von „Ein feste Burg ist unser Gott“ bei der Ernsten Feier des Wartburgfestes auflehnt und dieses Lied in den Wingolfsblättern als „Kampflied der Reformation“ bezeichnet. Auf diese – zugegebenermaßen etwas polemische Zuschreibung erntet er in den beiden Folgeheften vehementen Protest einiger evangelischer Theologen.
So weit ein kurzer Überblick über die Themen, mit denen sich die Wingolfsblätter bis 1967 beschäftigten. Dass dieser unvollständig bleiben muss, liegt angesichts der Fülle des Materials auf der Hand. Ein besonders wichtiges Thema wurde bisher jedoch allenfalls am Rande berührt: Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Wie stellten sich die Wingolfsblätter in jenen Jahren zu der Frage des Schuldigwerdens in der Zeit des Nationalsozialismus? Darauf soll im folgenden Abschnitt ausführlicher eingegangen werden.
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit
Die erste Ausgabe der wieder erstandenen Wingolfsblätter ist zum großen Teil eine Dokumentation der Wartburgtagung, die vom 7. bis zum 9. Juni 1949 in Eltville am Rhein stattfand. In der Ernsten Feier setzt Pfarrer Willi Merten (M 18, Bo 19, Mz 49) bereits einige der Schwerpunkte, welche die Zeitschrift in den folgenden Jahren prägen werden. Er predigt über ein Wort aus dem Buch des Propheten Sacharja (4,60): „Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.“
Merten interpretiert diesen Bibelvers als „ein Wort des Gerichts und zugleich ein Wort der Verheißung“. Dabei zieht er eine Parallele zur Gegenwart: „Heer und Kraft – Gott hat sie uns gründlich zerschlagen, er zerschlug unsre Städte, er verbrannte unsre Habe, er legte unser Volk in den Staub. In Strömen von Blut versanken Hochmut und sich selbst erhöhender Stolz, ertranken auf Macht und Gewalt gestützte Welteroberungspläne, schwanden die auf eigene Kraft trauenden Hoffnungen hin.“ Merten verweist auf die Toten des Wingolfs, er gedenkt „der Brüder aus unserer Mitte, die draußen auf den Schlachtfeldern fielen und derer, die – wie ein Paul Schneider – unter Henkershänden ihr Leben gelassen haben.“ Und voll Demut bekennt er: „Es ist nicht unser Verdienst, daß wir noch einmal neu anfangen dürfen. Es ist vielmehr ein Wunder vor unseren Augen und Gnade von Gott.“
Damit ist zunächst einmal der Ton für die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit gesetzt. Wie aber positionieren sich die Wingolfsblätter in den Folgejahren zu dieser Frage?
Im Februar 1950 drücken die Wingolfsblätter eine Rede des Bundes-x Heinz Miederer (E 48, Hg 50) ab, in der es heißt: „Daß der Wingolf mit einem überspitzten und falsch verstandenen Nationalismus nichts zu tun haben will, hat er klar und eindeutig bewiesen. Wir sind nicht mitgegangen, als das Pendel nach der einen Seite ausschlug, wir gehen auch nach der anderen Seite nicht mit.“
Dem heutigen Leser mögen angesichts dieser selbstsicheren Aussage Zweifel kommen. Einige der in der vorherigen Folge dieses Beitrags zur Geschichte der Wingolfsblätter zitierten Artikel aus den 1920er- und 1930er-Jahren sprechen doch eine andere Sprache. So eindeutig allem „überspitzten und falsch verstandenen Nationalismus“ abhold, wie Miederer es gerne sehen möchte, war der Wingolf in den 1920er- und 30er-Jahren sicherlich nicht gewesen. Eins jedoch lässt sich nicht bestreiten: Der Wingolf nach 1945 verabschiedet sich dezidiert von der früheren Art des „Hurrapatriotismus“. Oder, wie Dr. Rudolf Erkmann (Hg 25) es unter der Überschrift „Über unsere Vaterlandsliebe heute“ formuliert: „Vaterlandsliebe wird auf den Bannern des Wingolfs stehen, solange sie wehen. Aber es wird eine ganz andere sein müssen als die, die noch wir gepflegt. Sie sollte zunächst möglichst wenig Sache des Feierns sein, denn in seinem Rahmen ist sie am ersten in Gefahr, zum unfruchtbaren Rausch zu verflammen. Sie sollte ganz in die innere Linie der Verbindungsarbeit verlegt werden. Man sollte ihr dienen nicht mit dem Wort der Männer, die Deutschland gepriesen, sondern derer, die Deutschland auf sorgendem Herzen getragen haben.“
Ganz unumstritten war diese Position allerdings nicht. Bereits in der nächsten Folge erwidert Dr. Helmut Wohlfarth (Hg 24): „Ich glaube, es war eine echte Begeisterung, keine Gefühlswallung.“ Auf die Begeisterung in der Vaterlandsliebe zu verzichten, würde – so fürchtet er – die Gefahr mit sich bringen, „in eine noch sinnlosere Entleerung aller Werte zu geraten und die letzten Dämme zu beseitigen“.
Dass die Wingolfiten sich durchweg zum neuen, demokratischen Staatswesen bekannten, wurde oben bereits skizziert. Anders als in anderen Korporationsverbänden wurde es auch niemals ernsthaft in den Wingolfsblättern gefordert, dass man Deutscher sein müsse, um Wingolfit zu sein. Die gemeinsame Basis war das christliche Bekenntnis, nicht die Volkszugehörigkeit. Es bleibt jedoch die Frage, ob und inwieweit man sich der Vergangenheit – und zwar auch und vor allem ihren dunklen Seiten – stellte.
Der selbstkritische Blick und das Eingestehen von Schuld sind nie einfach. Oft braucht es den zeitlichen Abstand. Das war in der gesamten Gesellschaft der damaligen Bundesrepublik so und im Wingolf war es nicht anders. Ein erster Wendepunkt ist sicherlich das Heft 5 des Jahres 1954, in dem – leider ohne Nennung des Verfassers – unter der Überschrift „20. Juli“ die Vaterlandspauke abgedruckt ist, die auf dem Stiftungsfest des Hannoverschen Wingolfs gehalten wurde. In einer Zeit, in der manch einer in den Hitler-Attentätern vom 20. Juli 1944 noch Verräter sah, die ihren Eid gebrochen hatten, sprach der Hannoversche Redner von der „heiligen Verpflichtung, die uns das Erbe der Geschwister Scholl und ihrer Freunde und die Tat der Männer des 20. Juli 1944 in dieser Zeit und in der Gestaltung unseres Staatswesens auferlegt.“
Dass die Schriftleitung der Wingolfsblätter diese Überzeugung aus tiefster Seele teilt, zeigt sich darin, dass sie im März 1955 zwei Beiträge von Prof. Dr. Hans Rothfels abdruckt: Im März 1955 erscheint der Artikel „Wie stehen wir zur Geschichte?“, im Januar 1956 der Artikel „Zehn Jahre danach“, der sich mit dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Deutschlands im Mai 1945 beschäftigt. Hans Rothfels ist nicht irgendjemand: Er gilt als einer der renommiertesten Historiker und Begründer der modernen deutschen Zeitgeschichtsforschung. Seiner jüdischen Abstammung wegen wurde ihm 1934 sein Königsberger Lehrstuhl entzogen, nach kurzzeitiger Verhaftung im November 1938 gelang ihm 1939 die Emigration nach Großbritannien und von dort in die USA. 1951 kehrte er nach Deutschland zurück und übernahm eine Professur an der Universität Tübingen. Sein zuerst 1948 auf Englisch erschienenes Werk „Die deutsche Opposition gegen Hitler“ ist die erste wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem deutschen Widerstand. Mehrfach überarbeitet und erweitert galt sie jahrzehntelang als Standardwerk zu diesem Thema. Dass die Wingolfsblätter Hans Rothfels in den 1950er-Jahren einen so breiten Raum geben, ist sicherlich als ein sehr bewusstes Bekenntnis zu werten.
Im Januar 1957 erscheint erstmals eine ausführliche Würdigung des im Konzentrationslager Buchenwald ermordeten Wingolfiten Paul Schneider in den Wingolfsblättern. In Heft 4 desselben Jahres mahnte Hans Christhard Mahrenholz (G NStft 47, Hv NStft 52) unter der Überschrift „Der Wingolf wird vergeßlich“ eine intensivere Beschäftigung mit der jüngsten Vergangenheit, insbesondere mit der Durchsetzung des „Arierparagraphen“ an. Darüber empört sich zwei Hefte später Dr. Ernst August Lührs (Fr 19, G 20 et al.). Seiner Ansicht nach ist über die Vergangenheit genug gehandelt worden. Er schreibt u. a.: „Auch hier die Frage: cui bono?, wenn an Dinge gerührt wird, die endlich begraben sein sollten. ‚Arisierung des Wingolfs‘, sie liegt fast 25 Jahre und noch weiter zurück.“ Und einige Zeilen weiter schreibt Lührs: „Darum laßt ab von diesen Fragen. Wir können als Bund weder zum Hitlerstaat noch zu seinen einzelnen Problemen, wozu auch der 20.7.1944 gehört, irgendeine Stellung beziehen. Das ist Sache jedes einzelnen Bruders ganz für sich. Wir sollen und müssen da um der Brüder willen neutral und tolerant sein und bleiben.“ Dass eine solche Position keineswegs Mehrheitsmeinung im Wingolf ist zeigen die zahlreichen Zuschriften im Folgeheft, die alle betonen, wie wichtig die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit für den Wingolf sei.
Die Schriftleitung scheint das ähnlich zu sehen. Im selben Heft erscheint nämlich an erster Stelle ein Artikel des Journalisten Karl Marx, der nach der Rückkehr aus der Emigration als einer der Wiederbegründer der jüdischen Presse in Deutschland, gilt. Unter der Überschrift „Die neue Toleranz in Deutschland – Hat der Antisemitismus noch eine Chance?“ heißt es dort: „Ich stehe deshalb hinter dieser These von der Kollektivscham, die ja, im Gegensatz zur Kollektivschuld-These, keine Tatsache an sich wäre, unabhängig von der subjektiven Einstellung des einzelnen, sondern eine moralische Errungenschaft.“ Dem Artikel von Marx folgt ein zweiter, wingolfsspezifischer Beitrag mit der Überschrift „Wie kam es 1933 zur Forderung des Abstammungsnachweiseses im Wingolf? Wer trägt die Verantwortung dafür?“ In der Einleitung zu dem Beitrag heißt es:
„Die Zeit scheint uns reif zu sein, die Spalten der Wingolfsblätter obigem Thema zu öffnen. Es sind immerhin fast zehn Jahre ins Land gegangen, seit der Wingolf wieder auf dem Plan ist. Die praktischen Folgen jener Maßnahme sind längst beseitigt, nachdem die Bbr., die von der Lösungsweisung betroffen wurden, unsers Wissens alle in einer Haltung zu uns wiedergekommen sind, die Zeugnis dafür gibt, daß die wingolfitische Glaubensgemeinschaft doch gehalten hat. Sein Schuldbekenntnis hat der Wingolf als erste offizielle Erklärung bei der ersten Bundesveranstaltung nach dem Kriege in Marburg im Jahr 1948 gesprochen. Damals gab es die Wingolfsblätter noch nicht wieder; deshalb ist diese historische Tatsache nicht allgemein bekannt geworden. Nun ist die Frage erhoben, wieso denn jene unchristliche und unwingolfitische Maßnahme in unserer Gemeinschaft überhaupt geschehen konnte (…) und es ist Kritik am innersten Wesen des damaligen Wingolfs laut geworden (…). Wir haben daher den Historiographen des Wingolfs Dr. Dammermann (G 12, Gd 13) und den damaligen VAW-Vorsitzenden Dr. Lütkemann (M 10, G 12) gebeten, sich zu den einschlägigen Fragen zu äußern.“
Dammermann und Lütkemann geben nun eine sehr ausführliche und fundierte Stellungnahme ab. Darin schildern sie auch die Gewissenskonflikte, in denen sich Lütkemann selbst und vor allem Rodenhauser befunden hatten.
Manch andere Auseinandersetzung um die Vergangenheit lässt sich nur dann wahrnehmen, wenn man ein wenig zwischen den Zeilen liest: Im Januar 1958 bestellt der Geschäftsführende Ausschuss (der später Philisterrat heißt) erstmals wieder einen Generalsekretär. Die Wahl fällt auf Gerhard Mähner (Mch 29, E 53). Was dabei – zumindest in den Wingolfsblättern – an keiner Stelle erwähnt wird, ist die Tatsache, dass Mähner sich als junger Aktiver früh den Nationalsozialisten angeschlossen hatte und dann als Funktionär in der Reichsleitung des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes (NSDStB) massiv zur Gleichschaltung und schließlich zum Ende der studentischen Korporationen beigetragen hatte. Bekannt gewesen sein dürfte dies im Wingolf schon. Hugo Menze betont allerdings in der „Geschichte des Wingolfs“: „Doch inzwischen hatte Mähner, was die wenigsten wußten, die politische Verirrung seiner Jugend bereut, und er sah nun im neuerlichen Dienst am Wingolf eine selbstgewählte persönliche Wiedergutmachung.“ In der 2013 erschienenen Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des Freiburger Wingolfs heißt es hingegen, Mähner habe zurücktreten müssen, „nachdem seine Vergangenheit im Nationalsozialismus bekannt wurde und ein Versuch, diese mit der Freiburger Aktivitas zu diskutieren, nicht zur Beruhigung der Gemüter beitrug.“ Ein solcher erzwungener Rücktritt ist zumindest aus den Veröffentlichungen in den Wingolfsblättern nicht zu ersehen. Dort wird die nationalsozialistische Vergangenheit Mähners nur einmal zum Thema: in dem im Januar 1959 erschienenen „Dichterwettstreit“.
Dieser „Dichterwettstreit“ ist in gewisser Weise symptomatisch für den Umgang des Wingolfs mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in den 1950er- und der ersten Hälfte der 1960er-Jahre: Der Wingolf hat eingestanden, dass sowohl die Deutschen insgesamt als auch der Wingolf selbst Schuld auf sich geladen haben. Seine für die damalige Zeit durchaus beachtenswerte Art, mit der Schuld umzugehen, blieb naturgemäß nicht ohne Widerspruch, wurde aber von einer breiten Mehrheit der Wingolfiten getragen.
Schwieriger war es, wenn es persönlich wurde: Der Wingolf hat in seinen Reihen Täter, Mitläufer und Opfer des Nationalsozialismus gehabt. Die meisten Wingolfiten, die diese Zeit erlebt hatten, dürften alles zugleich gewesen sein – denn jeder Mensch hat seine mutigen und seine weniger mutigen, seine klarsichtigen und seine weniger klarsichtigen Momente im Leben. Nun saß man wieder gemeinsam bei Veranstaltungen, diskutierte und feierte. Man half zusammen, um Neues aufzubauen. Junge und ältere Bundesbrüder kamen über vieles ins Gespräch, auch über die Zeit des Nationalsozialismus. Aber dies geschah sozusagen auf einer „allgemeinen Ebene“. Denn würde man als jüngerer Wingolfit an der Kneiptafel sein – möglicherweise durchaus geschätztes – Gegenüber nach dessen persönlicher Schuld im Nationalsozialismus befragen? Und würde der ältere so ganz nebenbei über seine inneren Verletzungen, seine Gewissenskonflikte und gegebenenfalls auch über sein Versagen plaudern? Über die Albträume, die in der Nacht die schrecklichen Dinge, die er erlebt hat, wieder an die Oberfläche holen?
Es braucht einen größeren zeitlichen Abstand, bis eine neue Generation beginnt, einzelne Personen und ihre Haltung im Nationalsozialismus in den Blick zu nehmen – das ist im Wingolf nicht anders als in der deutschen Gesellschaft insgesamt. Auch in dieser Hinsicht sind der Wingolf und die Wingolfsblätter Kinder ihrer Zeit. Ob es gelingt, diese Auseinandersetzung ehrlich – ohne Selbstbetrug, aber auch ohne falsche Überheblichkeit – zu führen, wird eines der Themen in der nächsten Folge des Beitrags zur „Geschichte der Wingolfsblätter“ sein.
Konzeptionelle und drucktechnische Veränderungen
Zum Schluss dieses Kapitels der Wingolfsblätter-Geschichte soll noch ein Blick auf die „Äußerlichkeiten“ geworfen werden – Äußerlichkeiten, die sehr wohl auch Rückschlüsse auf gewisse Veränderungen in Inhalt, Schwerpunktsetzung und Umfeld der Wingolfsblätter zulassen: Welche Veränderungen an Druckbild, Layout, Papier, Format usw. sind zu vermerken? Gibt es Rubriken, deren Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein für den Charakter der Wingolfsblätter von Bedeutung sind? Solcherart sind die Fragen, denen in diesem Abschnitt nachgegangen werden soll.
Die ersten Nachkriegshefte haben auf den ersten Blick noch dieselbe Anmutung wie die Wingolfsblätter der 1920er- und 1930er-Jahre: Das Format ist nach wie vor dasselbe (28,5 cm hoch, 20 cm breit – also etwas kleiner als das DIN-A4-Format), das Layout ist ähnlich. Auffallend ist zum einen die schlechte Qualität des Papiers, die der wirtschaftlichen Not der Nachkriegszeit geschuldet sein dürfte, zum anderen das stark wechselnde Schriftbild: Manche Teile sind in Fraktur gesetzt, andere nicht. Das mag zum Teil Absicht sein, um die unterschiedlichen Arten von Text stärker gegeneinander abzusetzen. Einen weiteren Grund nennt Schriftleiter Karl Mench (ClzM 31): Demzufolge „haben sich sowohl inhaltlich wie technisch verschiedene Schwierigkeiten ergeben. Einmal fehlte es an Manuskripten und zum anderen an ausreichendem Schriftmaterial, das heute nur wenige Druckereien in genügendem Maße zur Verfügung haben, zumal dieses Heft besonders viel Satzzeichen erforderte.“
Neu ist übrigens, dass bereits ab dem ersten Heft 1949 der auf etwas stärkeres hellblaues Papier gedruckte Umschlag auf der Vorderseite von einer Zeichnung der Wartburg geziert wird. Auf diese Weise soll sowohl an die Wurzeln des Wingolfs als auch an die jenseits der Grenze im Osten lebenden Wingolfiten erinnert werden.
Eine Änderung des Formats erfolgt 1951. Es ist jetzt 20 cm hoch und 13,5 cm breit, also etwas kleiner als das DIN-A5-Format. Mench schreibt dazu: „Gründe finanzieller und technischer Art haben den Vertreter-Konvent und den geschäftsführenden Ausschuß des VAW bewogen, die Wingolfsblätter mit dem 70. Jahrgang in dem hier vorliegenden Format erscheinen zu lassen.“ Das Papier ist nach wie vor von schlechter Qualität, der Druck zum größten Teil in Frakturschrift. Das neue Format ist, wie Mench betont, „handlicher“, allerdings ist es – zumindest für heutige Gewohnheiten – auch deutlich leseunfreundlicher. Denn mit dem kleineren Format musste auch vom zwei- zum einspaltigen Layout gewechselt werden. Der etwas lockerere Zweispaltensatz hatte, verbunden mit Zwischenüberschriften bei längeren Artikeln, dem Auge des Lesers einen gewissen Halt geboten. Jetzt waren meist mehrere eng bedruckte Seiten mit wenig Randfläche und ohne Zwischenüberschrift oder gar Illustration zu „überstehen“.
Mit dem 72. Jahrgang (1953) wird dann die Frakturschrift aufgegeben, die Texte sind nun etwas stärker untergliedert und auch die Zahl der Illustrationen steigt langsam wieder. Wie dreißig Jahre zuvor spiegelt sich auch hier eine positive wirtschaftliche Entwicklung: Die Zahl der Wingolfiten, die die Möglichkeit haben, zu fotografieren und Bildmaterial beizusteuern, nimmt zu. Anlässlich von Wartburgfesten gibt es nun auch wieder Sonderseiten auf glänzendem Bilderdruckpapier, die die Berichterstattung durch Fotos ergänzen.
Auch sonst lässt sich der wirtschaftliche Aufschwung an den im Zweimonatsrhythmus erscheinenden Wingolfsblättern ablesen: Die Papierqualität wird zunehmend besser, der Umschlag – ab dem 74. Jahrgang 1955 beige statt hellblau – ist nun aus einem festeren Karton. Und mit dem 84. Jahrgang 1965 steht dann die nächste Veränderung an: Das Layout wird modernisiert und ist nun wesentlich lesefreundlicher, das Format ist von nun an das vielen der heutigen Leser noch vertraute DIN C5 (22,5 cm hoch und 16 cm breit, also größer als DIN A5 und kleiner als DIN A4).
Aussagekräftig sind auch die Veränderungen der Rubriken. Unter „Ceterum censeo“ haben von 1955 an die Wingolfiten die Möglichkeit, in kurzer, prägnanter Weise Stellung zu allgemeinen wie wingolfitischen Themen zu beziehen. Ab 1959 wird diese Rubrik von „Pro und Contra“ abgelöst. Beide Rubriken sind bemüht, einen bundesbrüderlichen Dialog zu strittigen Themen in Gang zu setzen. Die Rubriken „Hochschul-Rundschau“ und „Was andere schrieben“ richten den Blick auf das, was in anderen korporativen Dachverbänden, hochschulpolitischen Gruppen und an den einzelnen Universitäten geschieht.
Eingestellt wurde hingegen eine andere Rubrik: 1951 beschloss die Redaktion der Wingolfsblätter, die Berichte aus den einzelnen Wingolfsverbindungen nicht mehr vollständig abzudrucken. Gegen einen empörten Bundesantrag des Mainzer Wingolfs verteidigt die Redaktion diese Entscheidung und erklärt – wozu Journalisten und Redaktionen nur allzu oft gezwungen sind –, dass die Auswahl, Kürzung und Bearbeitung von Beiträgen keineswegs gleichbedeutend mit Zensur sind, sondern nichts als die notwendige redaktionelle Tätigkeit, ohne die statt einer lesbaren Zeitschrift lediglich ein unverdaulicher Papierwust produziert werden würde. Wie richtig es war, die obligatorischen Semesterberichte aufzugeben, zeigt auf satirische Weise einige Jahre später H. P. Reinhard (Bo 50) auf. Unter der Überschrift „Semester-Spätlese 08/15“ präsentiert er einen Muster-Semesterbericht, der folgendermaßen beginnt:
„Wieder liegt ein Wintersemester hinter uns! Wir sind gewiß, daß unser Bemühen um die wingolfitische Sache nicht umsonst war, und daß sich dieses Semester würdig in die Reihe seiner Vorgänger einreiht. Unser Semesterplan, den die Chargierten auf dem Antrittskonvent vorlegten, brachte unser heißes Bemühen um Glauben, Wissenschaftlichkeit und Brüderlichkeit zum Ausdruck. Das Semester begann mit einer stilvollen Ernsten Feier (…). Darauf folgte eine feuchtfröhliche Antrittskneipe, die uns bis zum frühen Morgen in brüderlicher Runde vereinte.“
In diesem Ton geht es weiter, die jeweilige Wingolfsverbindung lässt sich mühelos nach Gutdünken einsetzen. Auf ähnliche Weise der „Phrasendreschmaschine“ den Kampf anzusagen, wäre heutzutage sicherlich nicht weniger notwendig und verdienstvoll.