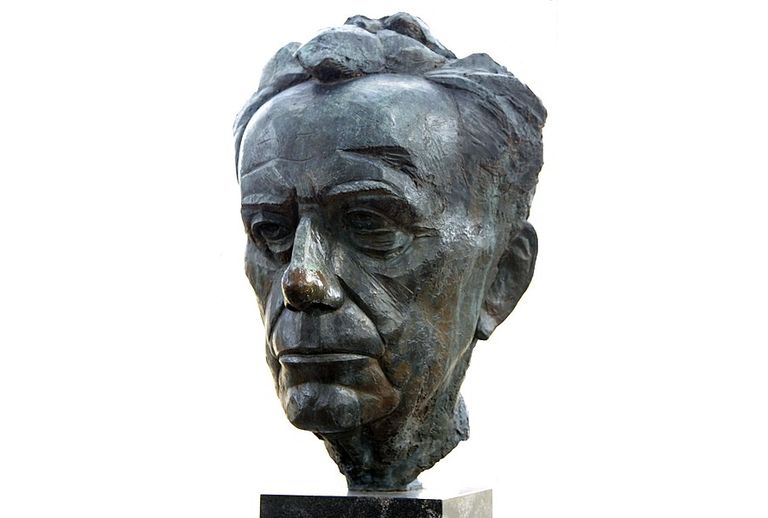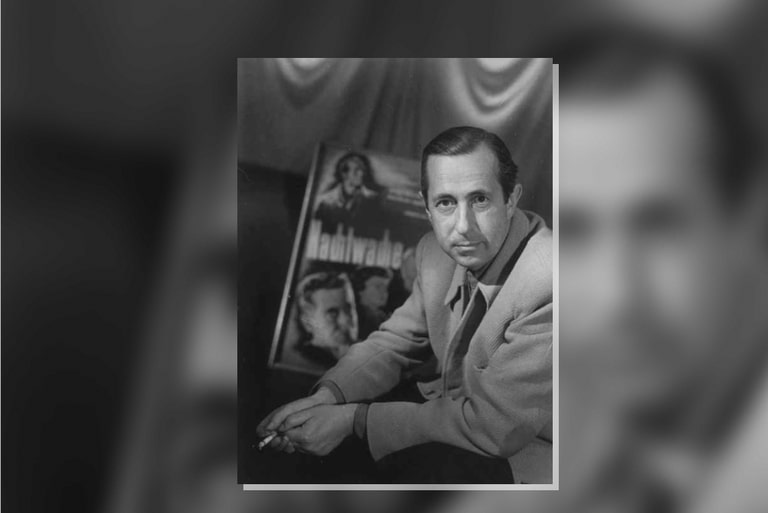Im Vergleich zu anderen Dachverbänden ist die Vielfalt bei den Farben der Wingolfsverbindungen mit zehn verschiedenen Kombinationen und Anordnungen immer noch sehr überschaubar. Dazu kommen allerdings noch Farbnuancen von kornblumenblau bis karmesinrot. Doch woher kommt diese Farbenvielfalt? Immerhin war der Wingolfsbund mit nur einer Farbkombination als gemeinsames Bundessymbol gestartet. Dies soll nun in diesem und einem weiteren Beitrag geklärt werden. Zunächst aber erstmal die Frage: Woher stammen die Bundesfarben selbst eigentlich?
Der Beitrag erschien im Original in Ausgabe 4/22 der Wingolfsblätter (S. 18–23). Autor ist Jan Deventer (Mst 18).
Die Entstehung der Bundesfarben
Seinen Ursprung haben die Bundesfarben beim Bonner Wingolf. Zunächst führte dieser die Farben Schwarz-Weiß in Wappen, Schärpen und Mützen. Das Schwarz-Weiß kann aus dem Bonner Stadtwappen, welches das schwarze Kurkölner Kreuz enthält, dem preußischen Landesfarben oder einer reinen Farbsymbolik (Schwarz für die Ernsthaftigkeit und Weiß für die sittliche Reinheit) entlehnt sein. Spätestens im WS1845/46 wurden die seitdem getragenen Farben Schwarz-Weiß-Gold angenommen, welche 1848 auch von Uttenruthia Erlangen und dem Berliner Wingolf übernommen wurde und zu den Farben des Wingolfs wurden.i
Zum Ursprung dieser Farbkombination sind im Laufe der Wingolfsgeschichte einige Theorien entstanden. Hermann Knodt (Gi99) sieht in ihnen die Kombination der Farben des Bonner Wingolfs (schwarz-weiß) und den der Uttenruthia Erlangen (schwarz-gold) und/oder einen Protest gegen das burschenschaftliche Schwarz-Rot-Gold.ii Die Erklärung, die sich durchgesetzt hat, stammt von Dr. Bernhard Dammermann (G12, Gd14) aus dem Jahr 1927. Dieser gab sich mit denen bis dahin verbreiteten Erklärungen nicht zufrieden und erklärte auch, dass Theorien wie der Ursprung als antiburschenschaftlicher Protest, ganz dem jeweiligen Zeitgeist, in dem Fall der 1890er, entspringen würden. Ein Vorwurf, der auch sehr gut auf seine Erklärung passt, denn sie ist eine sehr nationale, entstanden in einem sehr vaterländischen Zeitgeist: Laut Dammermann ist die Wingolfstrikolore eine Kombination der Farben Preußens und der Habsburger. Ernst Moritz Arndt habe sie dem Bonner Wingolf vorgeschlagen, denn er soll die Farben noch aus einem Vorschlag des Freiherrn vom Stein, der sie 1808 als gemeinsames Abzeichen für österreichische und preußische Verbände im Kampf gegen Napoleon vorschlug, gekannt haben. Der Vorschlag des Freiherrn war zwar nicht erfolgreich, aber Arndt soll, so spekuliert Dammermann, diesen zu Kenntnis genommen haben, als er 1812 dessen Privatsekretär war. Dammermann schreibt zwar selbst, dass seine Theorie nur auf Mutmaßungen ohne wirkliche Belege basiert,iii verdrängte sie die anderen Varianten. So findet sie sich seine Erklärung auch im Kleinen Lexikon des studentischen Brauchtums von Otto Böcher (Mz54, Hg56) wieder.iv
Woher stammt dann aber dann das Gold in den Farben, wenn Dammermanns und auch Knodts Erklärungen nur auf Vermutungen beruhen? Wahrscheinlich steht es schlicht für den christlichen Glauben. Schon beim ersten bekannten Bonner Wappen findet sich ein goldenes Kreuz. Und bei der Gründungsfeier des Hallenser Wingolfs wird diese Symbolik auch eindeutig ausgedrückt.v
Seit der Gründung des Wingolfsbundes 1844 sind 58 Verbindungen Mitglied gewesenvi, wovon jedoch 29, davon drei zeitweise, nicht die Bundesfarben wählten oder sie in einer anderen Reihenfolge anordneten. Dabei spielten ganz unterschiedliche Gründe eine Rolle.
Die frühen Abweichungen von den Bundesfarben beim Marburger Wingolf…
Bereits in den Anfängen des Wingolfs kommt es zur ersten Abweichung von den ab 1848 als Bundesfarben feststehenden Farben. Der Marburger Wingolf (MW) betonte zunächst gegenüber den anderen Wingolfsverbindungen seine Eigenständigkeit und nahm in Anlehnung an das Königreich Jerusalem, von dem auch das Jerusalemer Kreuz stammt, die Farben Gold-Weiß-Gold an. In dieser Zeit tauchen auch die späteren Farben Grün-Weiß-Gold das erste Mal auf. Dem Convent wurde ein Antrag vorgebracht die Verbindungsfarben in eben jene zu ändern, was allerdings abgelehnt wurde. 1851 spaltete sich die Progress-Burschenschaft Germania ab, die diese Farben schließlich wählten. Ob sie Idee dieses abgelehnten Antrags aufgriffen, ist nicht bekannt. Der MW nahm schließlich 1852 die Bundesfarben an, um die Einheit mit den anderen Wingolfsverbindungen im Gesamtwingolfvii zu zeigen. Als aber 1866 Preußen nach dem Deutschen Krieg das Kurfürstentum Hessen annektierte trat der MW als Protest aus dem Wingolfsbund aus. Bestrebungen seitens der Philisterschaft die Farben als Bekenntnis zu Hessen in Rot-Weiß-Gold zu ändern, wurde erst abgelehnt, aber ein halbes Jahr später Anfang 1867 angenommen. Getragen wurden die neuen Farben allerdings erst ein Jahr später und die Fahne wurde erst zum Stiftungsfest 1870 geändert. Im selben Jahr gründete sich der Altwingolf mit Bundesfarben, der vom WB als Nachfolger des MW von 1847 angesehen wurde. Das Verhältnis dieses roten und des schwarzen Wingolfs begann feindlich, aber 1875 konnten sich die beiden schließlich wiedervereinen. Bei dieser Vereinigung wurden die heute noch gültigen Farben Grün-Weiß-Gold als neutrale Farben gewählt. Zum Stiftungsfest 1875 wurde schließlich die Fahne, die Schärpen und die Schläger des roten Wingolfs zu grün umgefärbt. Wahrscheinlich wurden diese Farben infolge ihrer Symbolik gewählt (Grün für die Hoffnung).viii
…dem Heidelberger Wingolf und dem Leipziger Wingolf innerhalb der Landesgrenzen…
Während in Marburg ein wingolfsinterner Konflikt zu Abweichung von Bundesfarben führte, sind bei anderen Frühen Farbabweichungen Konflikte mit der Universität und/oder anderen Korporationen der Grund, so in Heidelberg und in Leipzig. In beiden Städten gründete sich zunächst je eine Verbindung unter den Namen Wingolf mit den Bundesfarben. Der Heidelberger Wingolf geriet jedoch rasch in Konflikt mit den örtlichen Corps, weshalb 1853 der Universitätssenat ihn verbot. Als Ersatz wurde 1856 die Arminia gegründet, die nicht Teil des Gesamtwingolfs wurde. Es wurden die Farben Dunkelblau-Weiß-Gold angenommen um den Bundesfarben möglichst nahe zu kommen. Diese Verbindung vertagte sich 1868. Bei der Reaktivierung 1881 konnte wieder der Name Wingolf angenommen werden, allerdings wurden die Arminenfarben auf Wunsch vieler Philister beibehalten.ix Der heutige Blauton wird auch als kornblumenblau bezeichnet.
Der Leipziger Wingolf (LW) dagegen erhielt 1855 erst keine Zulassung, denn die Universität vermutete burschenschaftliche Tendenzen und befürchtete Konflikte mit den örtlichen Corps. Als Ersatz wurde die Verbindung Wittenbergia gegründet ohne Verbindungen zum Gesamtwingolf. Zunächst mit den Farben Grün-Gold-Grün, ab dem SS1857 mit Grün-Weiß-Gold. Durch seine weiterhin bestehenden Kontakte zum Gesamtwingolf geriet die Verbindung weiterhin in Konflikt mit der Universität. 1858 vertagte sie sich schließlich.x Warum der LW diese Farben annahm ist nicht bekannt. Möglicherweise wollte er mit der Annahme der sächsischen Landesfarben dem Vorwurf der burschenschaftlichen Tendenzen entgegentreten. Bei seiner Wiedergründung 1865 konnte der LW wieder den Namen Wingolf samt Bundesfarben annehmen.
…sowie bei der Argentina Straßburg und der Arminia Dorpatensis außerhalb
1857 gründete sich noch eine weitere Wingolfsverbindungen, die nicht nur in Hinblick auf Farben besonders war: Argentina Straßburg. Noch in Frankreich gegründet, wählten die Argentinagründer in Anlehnung an das Stadtwappen Straßburgs, ein roter Schrägbalken auf silbernen Grund, die Farben Schwarz-Weiß-Rot. Sie wählten Weiß, da sie das Silber des Wappens zunächst für weiß hielten. Eine Unterscheidung, die es in der klassischen Heraldik nicht gibt, in der studentischen jedoch durchaus. 1860 wurde das erste Mal Couleur getragen, in Straßburg jedoch nur intern auf Kneipe, öffentlich nur in Deutschland oder der Schweiz. 1861 wurde das Weiß gegen Silber getauscht, wann genau der Rotton abgedunkelt wurde ist nicht bekannt. 1871 wurde Straßburg Teil des neugegründeten deutschen Kaiserreichs, dessen Farben Schwarz-Weiß-Rot waren. Um nicht für eine politische Verbindung gehalten zu werden, nahm Argentina 1872 die Bundesfarben an. 1881 und 1884 gab es nochmals Bestrebungen, die alten Farben wieder anzulegen. Dies scheiterte allerdings, denn 1880 hatte sich eine Burschenschaft mit eben jenen Farben in Straßburg gegründet.xi
Wie die Argentina gründete sich bereits 1850 eine Wingolfsverbindung außerhalb Deutschlands, nämlich die Arminia Dorpatensis als deutsch-baltische Verbindung im damals zum russischen Kaiserreich gehörenden Estland. Diese nahm die Farben Schwarz-Weiß-Altgold an. Weshalb das Gold der Bundesfarben zu Altgold geändert wurde, ist unklar. Oft wurde in Texten auch keine Unterscheidung zwischen Gold und Altgold gemacht.xii
Ursprüngliche Namens- und Farbvarianten u.a. in Kiel und München
Einige Wingolfsverbindungen wurden zwar mit dem Ziel Wingolf gegründet, jedoch trugen sie zunächst andere Namen und Farben. So in etwa gründete sich im Februar 1867 in Göttingen eine Arminia mit den Farben Schwarz-Silber-Rotxiii, 1896 eine Wittenbergia mit weiß-gold-rot in Münchenxiv und 1900 noch eine Wittenbergia mit den Farben schwarz-gold-blau in Stuttgart.xv All diese Verbindungen wurden innerhalb weniger Monate auch den Namen nach zu Wingolfsverbindungen und nahmen die Bundesfarben an. Anders verhielt es sich beim Kieler Wingolf. Hier wurde 1892 der Verein Wartburg gegründet mit dem Ziel eine Wingolfsverbindung zu werden. Da der Verein nicht die Bundesfarben annehmen durfte, nahm er die Farben Rot-Weiß-Gold an. Warum diese Farben gewählt wurden, ist nicht komplett gesichert. Eine alte Erklärung ist, dass dem Verein auf Initiative Bonns hin das alte Band des kurhessischen Marburger Wingolfs überreicht wurde.xvi Diese Erklärung wurde in neuere Zeit allerdings eher abgelehnt und auf eine Anlehnung an die Kieler Stadtfarben oder die Landesfarben Schleswig-Holsteins verwiesen.xvii Als allerdings der Verein 1895 zur Verbindung wurde, forderten Halle und Bonn nun, dass diese auch nun die Bundesfarben tragen sollen. Dies lehnte Kiel vehement ab und ein Farbenstreit entbrannte. xviii Einige Bundesbrüder waren der Meinung, dass ein Wingolfit nur schwarz-weiß-gold tragen dürfe und nichts anderes, obwohl in Heidelberg und Marburg bereits seit Jahrzehnten Bundesbrüder bereits andere Farben trugen. In diesem Farbenstreit konnte sich Kiel schließlich behaupten, sodass sie die Farben auch nach ihrer Aufnahme in den WB 1896 behalten durften.xix
Kiel und Marburg sind, bis heute, sehr stolz auf ihre Farben und sehen sie als Alleinstellungsmerkmal im Bund an, was dazu führte, die Annahme ihrer Farben durch andere Wingolfsverbindungen stets verhindern wollten.
Als sich 1903 der Münstersche Wingolf gründete, gab es erstmals bei einer Wingolfsverbindungsgründung ein Problem: Kurz vorher hatte sich eine katholische Verbindung gegründet, die die Farben schwarz-weiß-orange trug. Um Verwechselungen zu vermeiden, wurden die Farben Rot-Weiß-Gold in Anlehnung an die Stadtfarben Münsters Gold-Rot-Weiß gewählt. Der Kieler Wingolf protestierte jedoch gegen diese Entscheidung und ebenfalls kurz vorher hatte die örtliche ATV eben jene Farben gewählt. Daraufhin wurde ein dunklerer Rotton gewählt. Alle Parteien waren mit den neuen Farben Dunkelrot-Weiß-Gold einverstanden waren. Die Verbindung, die das Abweichen von den Bundesfarben vonnöten machte, vertagte sich bereits 1904 wieder für immer.xx
Voraussichtlich im März erscheint Teil II mit den Farbabweichungen in der Zwischenkriegszeit und der Nachkriegszeit bis heute.
Anmerkungen/Quellen
i# : Giesicke, Robert/Trautner, Martin [Hg.]: Aus den Anfängen des Wingolfs (1841-1849), Bonn 2016, S.14f.
ii# Wingolfsblätter 1919/20, S.12.
iii# Wingolfsblätter 1927, S.483ff. Siehe dazu auch: Giesicke, Robert/Trautner, Martin [Hg.]: Aus den Anfängen des Wingolfs (1841-1849), Bonn 2016, S.15f.
iv# Böcher, Otto: Kleines Lexikon des studentischen Brauchtums, Lahr 1985, S.46.
v# Giesicke, Robert/Trautner, Martin [Hg.]: Aus den Anfängen des Wingolfs (1841-1849), Bonn 2016, S.15.
vi# Inkl. Uttenruhtia Erlangen, Hohenstaufia Würzburg & Ottonia Magdeburg.
vii# Der Gesamtwingolf bestand von 1852 bis 1860 und wurde darauf zum Wingolfsbund. Siehe dazu: Wieltsch, Manfred: Die Anfänge und der Ausbau des Wingolfs 1830-1870, in: VAW [Hg.]: Geschichte des Wingolfs 1830-1994, Hannover 1998 ,S.78ff.
viii# Der Großteil der Informationen, vor allem die Details stammen aus persönlichen Nachfragen bei Phil Erhart Dettmering (M59) und Phil. Jürgen Schmidt (M65), die es den Protokollen des Marburger Wingolfs entnahmen. Ebenfalls dargestellt in: Heermann, Adolf: Geschichte des Marburger Wingolfs, Waitz, Hans [Hg.]: Geschichte der Wingolfsverbindungen, Darmstadt 1914, S.700ff.
ix# Kalchschmidt, Kurt/Kappes Georg: Geschichte des Heidelberger Wingolf, in: Waitz, Hans [Hg.]: Geschichte der Wingolfsverbindungen, Darmstadt 1914, S.515ff.
x# Benrich, Johannes: Die Geschichte des Leipziger Wingolf, in: Waitz, Hans [Hg.]: Geschichte der Wingolfsverbindungen, Darmstadt 1914, S616ff.
xi# Barth, Heinrich: Chronik der Studentenverbindung Argentina zu Straßburg i.E. 1907-1967, Oberhausen 1969, S.12. Bei der Burschenschaft handelt es sich um die Burschenschaft Germania. Sie verlegte 1919 nach Frankfurt und ist heute in Tübingen beheimatet.
xii# In Die Hauptmomente in der Geschichte des Chargiertenconvents, in: Baltische Monatsschrift 36(1894), S. 402 und in Ein Blatt der Erinnerung an die Dorpater Arminia, in: Wingolfsblätter 1930, S.460f werden die Farben der Arminia als Schwarz-Weiß-Gold beschrieben.
xiii# Kleinschmidt, Hans: Geschichte des Göttinger Wingolf, in: Waitz, Hans [Hg.]: Geschichte der Wingolfsverbindungen, Darmstadt 1914, S.356.
xiv# Verband der Philister des Münchener Wingolfs [Hg.]: 100 Jahre Münchener Wingolf, München 1996, S.6.
xv# VAStW [Hg.]: Der Stuttgarter Wingolf 1900-2000, Stuttgart 2000, S.15.
xvi# Weidemann, M.: Geschichte des Kieler Wingolfs, in: Waitz, Hans [Hg.]: Geschichte der Wingolfsverbindungen, Darmstadt 1914, S.580.
xvii# Wingolfsblätter 1991, S.29.
xviii# Weidemann, M.: Geschichte des Kieler Wingolfs, in: Waitz, Hans [Hg.]: Geschichte der Wingolfsverbindungen, Darmstadt 1914, S.580f.
xix# Wingolfsblätter 1991, S.29.
xx# Kiepenkerl 2/2022 [Seite unbekannt, da die Printversion zum Redaktionsschluss noch nicht erschienen ist]. Siehe dazu auch: Riegelmeyer, Peter: Der Münstersche Wingolf in Berichten I 1903-1936, in: VAMstW [Hg.]: 100 Jahre Münstersche Wingolf, Hannover 2005, S.76.